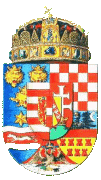Die Belle Epoque in Europa
Ungarn
Budapest
Nationalismus und Art Nouveau

Zur Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert wandte sich eine Gruppe avantgardistischer Kunstschaffender gegen den in dieser Epoche populären Eklektizismus, inspiriert durch den europäischen Art Nouveau. Die Mitglieder dieser "Secession" (gemeinsamer Begriff in Wien und Prag) orientierten sich an magyarischen und asiatischen ländlichen Traditionen und suchten einen ungarischen Nationalstil zu begründen. Die ungarische Architektur der Secession unterscheidet sich von anderen Bauwerken der Epoche nicht allein durch den dekorativen Stil, sondern auch durch die Verwendung moderner Techniken (Eisenbeton, Stahlstrukturen, Glas), welche die Schaffung weiter, heller Räume ermöglichten.
Historischer Abriss
Durch den Ausgleich von 1867 wurde im österreichisch-ungarischen Kaiserreich ein dualistisches Regierungssystem eingesetzt. Nach der Einsetzung dieser Doppelmonarchie erhob sich allerorten Kritik, doch erhielt sie auch von vielen Seiten Zustimmung: Von der Habsburger Dynastie, der beiden Staaten gemeinsamen Armee, der Feudalaristokratie, der katholischen Kirche, aber ebenso von den großen Kaufmanns- und Industriellenfamilien, die von den seit 1875 herrschenden Friedenszeiten profitierten.

In dieser Phase erlebte man eine beeindruckende Wandlung der ungarischen Gesellschaft. Die Aufgabe, politische Institutionen, eine Verwaltung und einen Staatshaushalt aufzubauen, oblag dem Adel und der Intelligenz; die von nationalen Gefühlen angetriebenen Kapitaleigner nahmen die wirtschaftliche Entwicklung in die Hand. Beide Aufgaben wurden mit Erfolg durchgeführt: Der Wohlstand wuchs, das Kapital mehrte sich, der Lebensstandard der Bauern stieg spektakulär und die nationale Kunst blühte auf.
Zwischen 1890 und 1919 erschien eine große Zahl ungarischer Sammler auf der Bildfläche, zu einem Großteil Magnaten mit unermesslichem Vermögen. Diese hatten sich beachtliche Verdienste hinsichtlich der Vergrößerung des Kulturschatzes des Landes erworben, unter ihnen Andrássy, der Werke zeitgenössischer ungarischer Künstler sowie einiger Neuerer der französischen Malerei wie Courbet, Rousseau oder Monet erstanden hatte.
Ebenfalls zu dieser Zeit bemühten sich die Intellektuellen darum, durch die gemeinsame Sprache und die Literatur die nationale Identität zu stärken. Alle künstlerischen Ausdrucksformen dienten in der Folge dazu, die Eigenständigkeit herauszustreichen. Die ältesten Volkstraditionen wurden wieder zum Leben erweckt, um die Prägung durch Österreich vergessen zu machen. Der Art Nouveau, welcher parallel zu diesen Entwicklungen entstand, diente so in bewundernswerter Weise den politischen Zwecken der sich konstituierenden Staaten oder den Städten, die sich von der Vormachtstellung der Hauptstädte befreien wollten. Die Architektur erschien als ein privilegiertes Mittel der Emanzipation. Als Prag und Budapest ihren Städtebau reformierten und zu großen, modernen Metropolen reiften, kamen die modernen Architekten wie gerufen.
In der Tat bot die ursprüngliche politische Situation in Mitteleuropa den Architekten des Art Nouveau die Gelegenheit, öffentliche Baudenkmäler zu errichten. Dies war der Fall für Ödön Lechner beim Bau des Kunstgewerbemuseums in Budapest. Solche Gelegenheiten ergaben sich in den Ländern der Großmächte viel seltener, wo, wie beispielsweise in Frankreich, öffentliche Aufträge in den Händen des Bildungsbürgertums lagen.
Alle Fotos aus Budapest wurden mir freundlicherweise von KuKS Hannover zur Verfügung gestellt, bei denen auch das © Copyright liegt.