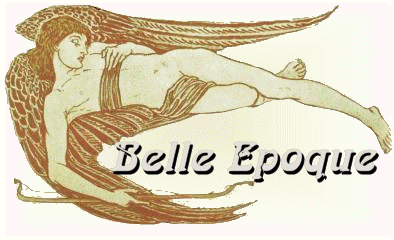Die Belle Epoque in Europa
Dänemark/Schweden: Stummfilm von Weltrang
Dänemark

Dänemark gehörte zu Beginn des Jahrhunderts für einige Jahre zu den führenden Filmländern der Welt. Dänemarks Filmpionier war Ole Olsen (1863-1943), Begründer der Nordisk Films Kompagni (1906), die lange Zeit den europäischen Films entscheidend prägte. Der erste von ihm produzierte Film war Løvejagten paa Ellore (Löwenjagd in Ellore, 1907), in der ein altersschwacher Zirkuslöwe realistisch zur Strecke gebracht wird. Doch bald wuden auch anspruchsvollere Filme gedreht: 1913 entstand August Bloms (?-1947) Atlantis nach Gerhard Hauptmann, Holger Madsen (1878-1943) drehte 1916 Ned med vaabene (Die Waffen nieder) nach dem Roman von Bertha von Suttner und 1918 Himmelskibet (Das Himmelsschiff), einen frühen Science-Fiction-Film.
Seine größten wirtschaftlichen Erfolge verdankte der dänische Film jedoch turbulenten Salonstücken in möglichst exotischem Milieu, in denen auch die Erotik eine für damalige Zeiten erstaunliche Rolle spielte. Filme wie Robert Dinesens (1874-1942) Maharajaens yndlingshustru (Die Lieblingsfrau des Maharadscha, 1916) oder Holger Madsens Tempeldanserindens elskov (Die Liebe der Tempeltänzerin) wurden Welterfolge. Zu diesen Erfolgen des dänischen Films trugen vergleichsweise seine Stars mehr bei als seine Regisseure. Valdemar Psilander (1884-1917), der auf dem Höhepunkt seiner Karriere Selbstmord beging, und Olaf Fønss (1882-1949), der seine Laufbahn später in Deutschland fortsetzte, waren weit über Dänemark hinaus bekannt und beliebt.
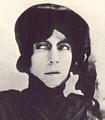
Aber die größte Entdeckung des dänischen Films war zweifellos Asta Nielsen (1881-1972), die 1910 unter der Regie von Urban Gad (1879-1947) in dem Film Afgrunden (Der Abgrund) debütierte. Eigentlich wollte sie mit diesem Film nur die Theaterdirektoren auf sich aufmerksam machen. Statt dessen wurde sie zum Weltstar, von dem das Publikum, die Kritiker und selbst die Dichter schwärmten. Schon ein Jahr nach ihrer Entdeckung allerdings verließ Asta Nielsen ihre Heimat und ging nach Deutschland, wo sie bis 1916 und dann wieder in den zwanziger Jahren Triumphe feierte.
Seltsamerweise haben die beiden bedeutendsten dänischen Regisseure jener Zeit, Carl Theodor Dreyer (1889-1968) und Benjamin Christensen (1879-1959), das Gesicht des dänischen Films weniger geprägt als die flinken Handwerker. Christensen debütierte schon 1913 mit dem Spionagefilm Det hemmelighedsfulde X (Das geheimnisvolle X) und errang ersten internationalen Ruhm mit seinem Episodenfilm Blade af satans bog (Blätter aus Satans Buch, 1920). Aber damals war die eigentliche Blütezeit des dänischen Films bereits vorüber. So arbeitete Dreyer mehrfach im Ausland - in Norwegen, Schweden, Deutschland und Frankreich, wo er mit La passion de Jeanne d'Arc (1928) einen der berühmtesten Stummfilme schuf.
Der dänische Film war zu dieser Zeit bereits zur Bedeutungslosigkeit abgesunken. International wurde er nur noch durch Pat und Patachon, Carl Schenstrøm (1881-1942) und Harald Madsen (1890-1919), vertreten, die lange Zeit das beliebteste europäische Komikerpaar waren.
Schweden

Mit dem Niedergang des dänischen Films begann der Aufstieg der schwedischen Filmkunst, die vor allem von den beiden Regisseuren Victor Sjøstrøm (1879-1960) und Mauritz Stiller (1883-1928) repräsentiert wurde. Beide hatten um 1912 angefangen, Filme zu inszenieren, und beide hatten zunächst die dänischen Filme nachgeahmt. Als erster machte sich Sjø;strøm von diesen Vorbildern frei. Mit seinen Filmen Terje Vigen (1916) und Berg-Eyvind och hans hustru (Berg-Eyvind und sein Weib, 1917) fand er eine persönliche Handschrift und prägte gleichzeitig den "skandinavischen Filmstil", der damals zahlreiche Filmkünstler in Europa und den USA beeinflusste. Sjøstrøm erzählte einfache Geschichten, mehrfach nach literarischen Vorlagen von Selma Lagerlöf, mit einer gradlinigen, dramatischen Handlung. Vor allem aber gelangen ihm realistische Naturschilderungen, die nicht zufällige Dekoration blieben, sondern wesentlicher Bestandteil der Handlung wurden. Geschick und Geschmack bewies Sjøstrøm auch in der Darstellung des Unwirklichen. So ließ er in seinem Film Ingmarssønerna (Die Ingmars-Söhne, 1918), der nach dem ersten Teil von Selma Lagerlöfs Roman Jerusalem entstand, seinen Helden in einer viel zitierten Szene bei seinen Vorfahren im Himmel Rat suchen. Und auch in Kørkarlen (Der Fuhrmann des Todes, 1920) erreichte er durch visuelle Mittel eine Stimmung, die das Übernatürliche überzeugend integrierte.

Sjøstrøm ging 1922 nach Hollywood, wo er noch einige bemerkenswerte Filme schuf. Als er 1930 nach Schweden zurückkehrte, war die Blütezeit des schwedischen Films vorüber. Er konnte nur noch einen einzigen Film in seiner Heimat inszenieren.
Mauritz Stiller bevorzugte zunächst ähnliche Sujets wie Sjøstrøm, behandelte sie aber weniger lyrisch-romantisch als vielmehr dramatisch, mit kräftigen Effekten. Einer seiner größten Erfolge wurde die Lagerlöf-Verfilmung Herr Arnes pengar (Herrn Arnes Schatz, 1919). Daneben entwickelte er mit Riddaren av igar (Erotikon, 1920) einen Typ der Filmkomödie, von dem u. a. Ernst Lubitsch beeinflusst wurde. In seinem Film Gøsta Berlings saga (1923) debütierte die Schauspielerin Greta Garbo (1905-1990). Mit ihr ging Stiller 1925 nach Hollywood. Nach geringem Erfolg kehrte er 1928 enttäuscht zurück. Er starb in demselben Jahr. Mit dem Engagement von Sjøstrøm und Stiller nach Hollywood war die große Zeit des schwedischen Stummfilms praktisch beendet.