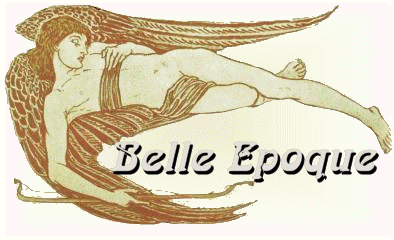Die Belle Epoque in Europa
Deutschland: Erste kommerzielle und künstlerische Erfolge

Am 1. November 1895 führten die Brüder Emil und Max Skladanowsky (1863-1939) im Berliner Varieté "Wintergarten" die ersten "lebenden Bilder" vor. Sie zeigten gefilmte Jahrmarktsattraktionen wie Das boxende Känguru und Straßenbilder aus Berlin. Der dritte Bruder, Eugen, hatte später die Idee, für die Vorführungen komische Zwischenspiele zu schaffen, und drehte Kurzfilme wie Die Fliegenjagd und Eine moderne Jungfrau von Orléans (1896), der etwa 15 Minuten lang war. Jedoch war der Apparat der Brüder Skladanowsky dem Kinematographen Lumières technisch unterlegen und es fehlte ihnen an Geld, um ihre Erfindung auszubauen und auszuwerten.
Oskar Messter, der auf die Fabrikation von Projektoren spezialisiert war, hatte auch dadurch mehr Erfolg, dass er eigene Filme produzierte, die seinen Kunden Nachschub garantierten. Zunächst filmte auch er Straßenbilder von Berlin; im Jahre 1896 aber eröffnete er das erste "Kunstlicht-Atelier". Seine Debütfilme waren kleine Burlesken wie Frisch gestrichen und Die gemütliche Kaffeetafel, zu welchem er seine eigene Familie filmte.
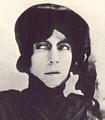
Bis etwa 1910 blieb die deutsche Filmproduktion unbedeutend. In jenem Jahr jedoch spielte Henny Porten (1890-1960) bei Messter ihre erste Hauptrolle in dem Rührstück Das Liebesglück einer Blinden, das einen großen Erfolg hatte. Im darauf folgenden Jahr wurden in Berlin zahlreiche neue Kinopaläste eröffnet. Ebenfalls 1911 kam die dänische Schauspielerin Asta Nielsen (1881-1972) mit ihrem Ehemann, dem Regisseur Urban Gad (1879-1947), nach Deutschland. Der erste deutsche Film von Asta Nielsen war Nachtfalter (1911), dem bis Mitte des Ersten Weltkriegs eine ganze Reihe weiterer folgten wie Der fremde Vogel (1911), Die arme Jenny (1911/12), Das Mädchen ohne Vaterland (1912), Engelein (1913), Die Suffragette (1913) und Die ewige Nacht (1914). In all diesen Filmen führte ihr Mann Urban Gad Regie, doch der Erfolg war in erster Linie Asta Nielsen zu verdanken, die durch ihr nuanciertes Spiel und die überlegte Geste zu einem großen Star wurde, der seiner Zeit weit voraus war.
1913 wurden in Deutschland bereits 313 Filme produziert, zumeist Zwei- und Dreiakter. Der zunächst in Deutschland und anschließend in Hollywood als Regisseur berühmt gewordene Ernst Lubitsch (1892-1947) drehte 1913 als Schauspieler unter dem Regisseur Carl Wilhelm seinen ersten Leinwand-Erfolg, Die Firma heiratet, dem wenig später eine Fortsetzung folgte, Der Stolz der Firma (1914).
Doch zu Anfang des 20. Jahrhunderts erlebte man die Geburt der Genre, welche wir heute mit dem Beginn des Kinos verbinden. Die Handlung eines Films spielte mehr und mehr eine wichtige Rolle. Unter Zeccas Leitung entstand eine erste Version von Quo Vadis (1901), Dramen aus dem Alltag wie Les victimes de l'alcoolisme (1902) und Passion (1902/03). Klassiker der Literatur wurden verfilmt. Albert Capellani (1870-1931), der für Pathé arbeitete, war einer der bekanntesten Regisseure für diese Art von Film. Nach den Romanen von Emile Zola drehte er L'Assommoir (1909) und Germinal (1913), nach Victor Hugo Notre Dame de Paris (1911) und Les Misérables (1912). Les Misérables war bis dahin der längste Film der Epoche mit einer Dauer von 3 ½ Stunden!

Mittlerweile fingen auch Bühnenschauspieler an, sich für den Film zu interessieren. So spielte beispielsweise Albert Bassermann (1867-1952) in dem Film Der Andere (1913) von Max Mack (1884-1973). Der berühmte Berliner Theaterregisseur Max Reinhardt (1873-1940) drehte mit Mitgliedern seines Ensembles Eine venetianische Nacht (1913). Wesentlich mehr Bedeutung kam jedoch dem Schauspieler Paul Wegener (1874-1948) zu. Unter dem dänischen Regisseur Stellan Rye (1880-1914) spielte er in dem Film Der Student von Prag (1913). Die mystische Geschichte vom armen Studenten, der dem Teufel sein Spiegelbild verkauft und daran zu Grunde geht, wurde auch im Ausland ein großer Erfolg. Als Regisseur hatte Wegener ebenso großen Erfolg, vor dem Ersten Weltkrieg z. B. mit dem ebenfalls in der Welt der Mythen und Märchen spielenden Film Der Golem (1914).
Hier finden sich bereits die Anfänge des filmischen Expressionismus, der dem deutschen Nachkriegsfilm in den zwanziger Jahren zu Weltruhm verhalf.